Vom Bikepacking zum Ultra-Rennen - Teil 1: Training

Viele von uns kennen dieses Gefühl: Die Taschen sind gepackt, du sitzt auf dem Rad, du fährst in deinem Tempo und genießt die Ruhe. Aber vielleicht fragst du dich inzwischen: Wie wäre es, das Ganze als Rennen zu fahren? Nicht nur Abenteuer, sondern Startnummer. Nicht nur für dich, sondern im Vergleich mit anderen. Vielleicht hast du dir beim Dotwatchen schon mal deinen eigenen Punkt auf der Karte vorgestellt.
In dieser zweiteiligen Serie zeigen wir, wie du den Schritt vom entspannten Bikepacking hin zu deinem ersten Ultra Cycling Race schaffst.
Teil 1: Training – wie du dich körperlich und mental auf dein erstes Ultra-Rennen vorbereitest
Teil 2: Ernährung – wie du deinen Körper davor, währenddessen und danach optimal versorgst
Beide Teile stammen von Max Kinzlbauer – einem erfahrenen Trainer im Ultra-Radsport und unter anderem Coach von Christoph Strasser. Er hat diesen Artikel exklusiv für uns geschrieben, um möglichst vielen den Einstieg in die Welt des Ultra Cycling zu erleichtern. Seine Tipps basieren auf jahrelanger Erfahrung und begleiten dich auf dem Weg vom Bikepacking-Abenteuer zum ersten Ultrarennen.
TEIL 1: TRAINING
Der Schritt von mehrtägigen Radtouren zu mehrtägigen Rennen ist oft kleiner als man glaubt. Viel Stress entsteht im Kopf. Der Körper kann das meistens längst.
Warum sollte es einen großen Unterschied machen, ob du allein eine 1000-km-Tour machst und dir keine großen Gedanken machst (Versorgung, Fitness, Geschwindigkeit etc.) – oder ob du dieselbe Distanz im Rahmen einer organisierten Veranstaltung fährst?
Solange die Karenzzeiten (Cut-offs) nicht extrem eng gerechnet sind, ist es am Ende eine Frage der Perspektive. Es ist wie bei einem Marathon: Fast jede und jeder kann einen Marathon bewältigen. Ob du 3 Stunden brauchst oder 8 Stunden, am Ende bist du trotzdem den Marathon gefahren. Die Zielzeit ist zweitrangig, vor allem beim ersten Mal.
Wichtig ist, dass du für dich entscheidest:
-
Willst du sportlich fahren, mit klarer Platzierung im Kopf?
-
Oder willst du ankommen, Erfahrungen sammeln und schauen, wie du dich fühlst?
Je unstrukturierter und weniger gut du vorbereitet bist, desto gemütlicher und mit desto weniger Ambition solltest du an das Rennen herangehen. Es ist absolut legitim zu sagen: „Ich fahre das Ding einfach fertig.“
Empfehlung von Max:
Starte mit einem Wettkampf, dessen Distanz du in deiner Freizeit schon einmal gut geschafft hast. So nimmst du den Druck raus, weil dein Körper weiß: „Das habe ich schon mal gemacht.“ Mach dir am Anfang keinen zu großen Stress wegen Versorgung – du hast es ja schon einmal irgendwie hinbekommen.
Worauf du aber achten solltest:
Die drei Kontaktpunkte. Fuß. Gesäß. Hand.
Solange du dort keine großen orthopädischen Probleme bekommst (Taubheit, Schmerzen, Druckstellen), kann eigentlich nicht viel schiefgehen. Je mehr Trainingskilometer du vorher gesammelt hast, desto besser hast du diese Themen in den Griff bekommen und desto besser geht es dir im Rennen.
Wenn du stärker werden willst: Umfang, Struktur – oder beides
Vielleicht wirst du nach dem ersten Event etwas ehrgeiziger und möchtest dich steigern. Dann hast du laut Max drei Möglichkeiten:
-
Du fährst mehr Stunden.
-
Du trainierst strukturierter.
-
Du kombinierst beides (das ist meist am besten).
1. Umfang steigern
Ausgangspunkt ist dein gewohnter Wochenumfang. Wenn du regelmäßig fährst, nimm den Schnitt der letzten 4–5 Wochen. Wenn du eher unregelmäßig fährst, such dir aus den letzten 6–8 Wochen die Wochen raus, die ähnlich lang waren, und nimm diese als Basis.
Dann:
-
Steigere diesen Umfang 2–3 Wochen lang um 10–20 %.
-
Danach kommt eine Deload-Woche (Erholungswoche) mit 20–40 % weniger Umfang als deine normale Ausgangswoche.
Also ganz praktisch:
2–3 Wochen etwas mehr als gewohnt,
dann 1 Woche weniger als gewohnt.
Das gibt dem Körper Zeit, sich zu erholen und sich anzupassen.
Verteile die Fahrzeiten in der Woche so gleichmäßig und so häufig wie möglich. Nicht alles in einen Monster-Block am Sonntag pressen, sondern lieber mehrfach fahren. Häufigkeit schlägt Einzeltag.
Falls du zeitlich schon am Limit bist und keine weiteren Stunden mehr reinbekommst, dann kommt Punkt 2 ins Spiel: Struktur.
2. Struktur ins Training bringen
Struktur heißt: Du setzt in deinen Einheiten gezielte Reize mit Absicht. Es geht nicht darum, immer „schnell“ zu fahren, sondern darum, unterschiedliche Trainingsarten sinnvoll einzusetzen.
Max unterscheidet drei Bausteine, die für Ultra extrem relevant sind:
-
HIT
-
Sweet Spot
-
K3
Diese drei Einheiten decken unterschiedliche Systeme ab und ergänzen sich gut.
Baustein 1: HIT (High Intensity Training)
HIT = sehr harte Intervalle. Ziel: Herz pumpt hoch, maximale Sauerstoffzufuhr zu den Muskeln, hoher Stress für das System.
Warum hart? Weil sich dein Körper nur dann weiterentwickelt, wenn du ihn aus der Komfortzone holst. Wenn der Reiz immer gleich bleibt, kommst du irgendwann in einen Dauerzustand, in dem du dich nicht weiter verbesserst.
So sieht eine HIT-Einheit aus:
-
Beispiel: 4 × 3 Minuten hart fahren bei RPE 8–9
(RPE = „Rate of Perceived Exertion“, subjektives Belastungsempfinden von 1 = superlocker bis 10 = all-out) -
Pausenlänge: 2–3 Minuten ganz locker weiterrollen
-
Später kannst du auf 6–7 × 3 Minuten steigern
-
Danach kannst du zu längeren Intervallen wechseln, z. B. 4–8 Minuten am Stück
Grundregel:
Die Summe der intensiven Intervalle in einer Einheit sollte zwischen 15 und 32 Minuten liegen.
Beispiele:
-
4×4 min
-
6×4 min
-
4×8 min
-
5×6 min
-
6×3 min
oder andere Kombinationen
Wenn du auf längere Intervalldauern gehst, verkürzt du die Pause auf ungefähr die halbe Intervallzeit. Also z. B. 6 Minuten Belastung, 3 Minuten Pause.
Wichtig:
Die Pause ist Erholung, aber aktiv. Das heißt: locker weiterkurbeln, nicht komplett stehenbleiben.
Es gibt auch sehr kurze Varianten wie 30 Sekunden Belastung / 15 Sekunden Pause, viele Wiederholungen, mehrere Serien. Die Vielfalt ist riesig. Max konzentriert sich hier bewusst auf klassische Intervalle, weil sie auch einen zweiten Effekt haben: Du lernst, für eine gewisse Zeit konstant Druck am Pedal zu halten. Das brauchst du später im Rennen, vor allem am Berg und gegen den Wind.
Ernährung bei HIT:
-
Einheiten bis 90 Minuten: ca. 60 g Kohlenhydrate pro Stunde reichen.
-
Härtere Sessions über 90 Minuten: hoch bis 90 g/h, aber nur wenn du generell hohe Absolut-Watt trittst.
-
Kleinere, leichtere Fahrer:innen kommen oft mit 70 g/h gut hin.
Warum Carbs? Damit du die Intervalle wirklich mit Qualität fahren kannst. Nach der Einheit hilft gutes Auffüllen der Speicher (= Kohlenhydrate danach), die Regeneration zu beschleunigen.
Baustein 2: Sweet Spot
Sweet Spot ist eine Intensität zwischen locker und hart: Druck am Pedal, aber es ist noch kontrollierbar.
Orientierung:
-
subjektiv RPE 5–8
-
oder 83–93 % FTP (FTP = Functional Threshold Power, grob gesagt die Leistung, die du ungefähr eine Stunde fahren kannst)
Länge der Intervalle:
-
Am Anfang: 4 × 5 Minuten
-
Pausenlänge flexibel: 3–10 Minuten oder sogar länger ist völlig okay
-
Später: 3–4 × 15 Minuten mit 5–10 Minuten Pause
-
Mit der Zeit (über Wochen bis Monate): steigern bis zu 3 × 20–30 Minuten, mit eher kurzen Pausen (10–15 Minuten)
Warum ist das wichtig?
Sweet-Spot-Intervalle verbessern zwei Dinge, die du für lange Distanzen brauchst:
-
Du lernst, mit konstantem Druck zu fahren.
-
Deine Energiebereitstellung für lange, zügige Abschnitte wird effizienter.
Ernährung bei Sweet Spot:
Diese Belastung fordert dein Energiesystem stark. Deshalb sind 50–70 g Kohlenhydrate pro Stunde zwingend notwendig, um die Qualität hochzuhalten und die Erholung danach nicht unnötig zu verlängern.
Es gibt Trainingsformen, bei denen man diese Sessions absichtlich mit weniger Kohlenhydraten fährt. Max sagt aber ganz klar: Für Einsteiger:innen ins strukturierte Training ist die Qualität der Intervalle deutlich wichtiger als solche „Low Carb“-Experimente. Minderversorgung kann den Gesamtprozess mehr kaputt machen als sie bringt.
Baustein 3: K3
K3 sind Sweet-Spot-Intervalle mit sehr niedriger Trittfrequenz (Cadence 40–60 rpm). Das heißt: viel Drehmoment, viel Kraft pro Pedaltritt.
Warum wichtig?
-
Die kräftigen, „großen“ Muskelfasern werden früh mit in die Arbeit geholt.
-
Diese Fasern lernen, ihre Energiebereitstellung effizienter zu gestalten.
-
Gleichzeitig stärkt diese Art von Arbeit die passiven Strukturen: Gelenke, Sehnen, Bindegewebe.
Deshalb wird K3 oft auch „Kraftausdauertraining“ genannt. Physiologisch ist es nicht dasselbe wie klassisches Kraftausdauertraining im Kraftraum, aber der Effekt am Rad ist ähnlich: stabiler Druck auf dem Pedal über lange Zeit.
So steigst du ein:
-
Fang nicht ultra-schwer an.
-
Zu Beginn: kurze Blöcke an leichten Anstiegen
z. B. 3–4 × 4–6 Minuten -
Später, nach Wochen/Monaten Gewöhnung:
bis zu 3 × 20 Minuten möglich
Ganz wichtig bei K3:
Der Oberkörper muss ruhig bleiben. Du solltest nicht anfangen, dich zu verkanten oder hochzuwippen. Sonst wanderst du in eine ungesunde Haltung. Deshalb langsam steigern.
Ernährung bei K3:
40–60 g Kohlenhydrate pro Stunde, je nach Länge der Einheit. Auch hier gibt es Low-Carb-Ansätze, aber das gehört eher später in den Prozess, wenn überhaupt.
Hinweis Protein:
Eine gute Proteinzufuhr unterstützt diese Art von Training zusätzlich. Richtwert laut Max:
-
Vielfahrer:innen: ca. 1,5 g Protein pro kg Körpergewicht pro Tag
-
Bei sehr hohen Umfängen: bis 2 g/kg oder mehr
-
Ältere Athlet:innen sollten eher Richtung obere Grenze gehen, weil die natürliche Proteinsynthese im Alter sinkt. Mehrere kleinere proteinreiche Mahlzeiten oder Snacks pro Tag helfen, das Level oben zu halten.
Im Rennen selbst musst du nicht permanent diese hohen Proteinmengen erreichen. Das gilt eher für die Trainingsphase. K3 stärkt durch die Belastung auch passive Strukturen wie Sehnen und andere Bindegewebe. Das ist ein Pluspunkt für Ultrabelastungen.
3. Grundlage / Base
Grundlagentraining (Basis / Base) ist der Bereich, den du viele Stunden fahren können solltest, ohne „leerzulaufen“. Viele fahren diese Zone zu hart.
Orientierung:
-
50–70 % FTP
-
oder RPE 3–5 (also deutlich unter „anstrengend“)
Die Herzfrequenz lässt Max bewusst außen vor. Grund: Puls hängt von sehr vielen Faktoren ab (Hitze, Schlaf, Stress, Koffein, Dehydration). Für Leute mit viel Erfahrung kann Pulsanalyse in der Nachbetrachtung sehr spannend sein. Für Neueinsteiger:innen führt es eher zu Verwirrung und Unsicherheit.
Grundprinzip:
Locker soll wirklich locker sein. Sonst fehlt dir später die Frische für die hochwertigen Einheiten.
4. So kombinierst du die Einheiten in der Praxis
Max schlägt eine sinnvolle Reihenfolge vor, vor allem für Phasen, in denen du etwas ambitionierter werden willst:
-
Zuerst die härteste, qualitativste Einheit: HIT
Wichtig: in ausgeruhtem Zustand fahren, z. B. nach 1–2 Ruhetagen. -
Danach eine Sweet-Spot-Session
Druck am Pedal, aber machbar. -
Danach eine K3-Einheit
Kraft- und Stabilitätsfokus. -
Danach eine Grundlagensession
Ruhiges Fahren, lockere Belastung.
Für Einsteiger:innen:
Zwischen diesen Einheiten gerne zusätzliche Grundlagentage oder auch mal komplette Ruhetage einbauen. Du musst nicht Tag 1–4 voll ballern.
Abfolge-Idee von Max:
Erst die harte Qualität,
dann etwas „kontrolliert hart“,
dann kraftbetont,
dann locker.
Wichtig:
Alle 3–5 Wochen (je nach Ermüdung durch Umfang und Intensität) sollte eine Ruhewoche kommen. Ruhewoche heißt: weniger Intensitäten, gleicher oder geringerer Umfang. Die lockeren Einheiten in dieser Woche wirklich locker fahren. Vielleicht eine kurze Sweet-Spot-Session, aber mit insgesamt wenig Gesamtbelastung.
Warum?
Weil der Körper sonst keine Chance bekommt, sich zu reparieren. Diese Reparatur betrifft nicht nur Muskeln, sondern auch passive Strukturen (Sehnen, Bindegewebe etc). Und da kommt – wie Max sagt – das Protein wieder ins Spiel.

Mit diesen Grundlagen hast du alles, was du brauchst, um dein Training gezielt auf dein erstes Ultrarennen auszurichten. Egal, ob du einfach ankommen oder deine persönliche Bestleistung abrufen willst.
Im kommenden Teil 2 geht es um das zweite große Thema: Ernährung. Dort erfährst du, wie du deine Energie über Stunden und Tage konstant hältst, was du im Training bereits üben solltest und worauf es im Rennen wirklich ankommt.
Der Artikel wurde von Max Kinzlbauer verfasst, einem erfahrenen Trainer im Ultra-Radsport und Coach von Christoph Strasser. Mehr über seine Arbeit findest du hier.
@mk_training_max
Bildmaterial:
@lft.crw@jo_fietser
@ohhmyycaptain@maximilianpoliteFotograf: @naturbuasch
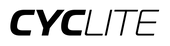
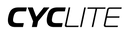
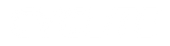
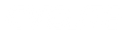



Hinterlassen Sie einen Kommentar